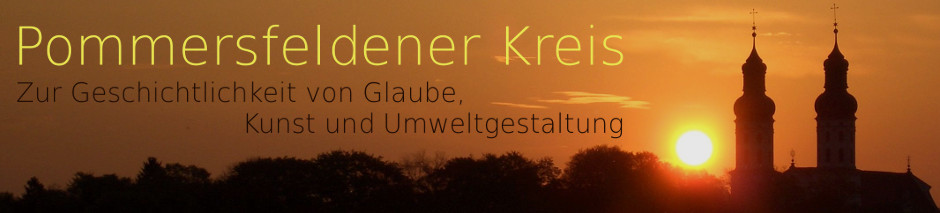Weil Epikur die Lust als höchstes Gut und Glück des Lebens angesetzt hat, geht seit der Antike die Fama, er habe ein Leben in ausschweifenden sinnlichen Genüssen aller Art propagiert.
Dass das nicht wahr sein kann, sieht man schon daran, dass Seneca, der wie alle Stoiker Lust- und Unlustgefühle als Affekte austreiben wollte, Epikur attestiert, er schreibe sittlich Einwandfreies und Richtiges vor. In der Tat gibt es im Effekt kaum Unterschiede zwischen dem epikureischen lustvollen Leben ohne Aufregung (ataraxia) und dem stoischen tugendhaften Leben ohne Affekte (apatheia). Woran liegt das? Es liegt am Lustbegriff Epikurs. Lust ist nichts, was von sich aus kein Maß und keine Grenze (kein peras, so Platon) kennt, sondern in sich selbst ein Maß hat. Lust ist für Epikur nichts anderes als Freiheit von Unlust, d.h. von Schmerz jeder Art. Vor jeder rationalen Überlegung orientieren wir uns beim Wählen oder Meiden nach dem angeborenen Wertkriterium der Lust als Freiheit von Unlust. Dabei unterscheidet Epikur zwei Arten von Lust: Lust, die sich einstellt bei Behebung eines Mangels, z.B. des Durstes durch Trinken, nennt er Lust in Bewegung. Lust, die im Erreichen des Zieles dieser Bewegung, z.B. im Gelöschtsein des Durstes, besteht, nennt er zuständliche Lust. Zuständliche Lust lässt sich nicht steigern: Man kann nicht satter sein als satt, nicht freier von Unlust als frei, wie man nicht gesünder sein kann als gesund. Man sieht sogleich, dass das Ziel zuständlicher Lust mit den einfachsten Mitteln zu erreichen ist, mit Mitteln, die ihrerseits so unlustfrei wie möglich zu beschaffen sind. Der Durst kann mit Wasser gelöscht, der Hunger mit Brot und Naturprodukten gestillt werden. Der Genuss von Wein und feineren Speisen ist als Variation zwar nicht nötig, aber durchaus erlaubt, so lange dadurch die Ausgeglichenheit zuständlicher Lust nicht gestört wird. Weil durch Vernunft Beziehung auf Vergangenes (Erinnerung) und Zukünftiges (Erwartung) möglich ist, gibt es bei Epikur auch geistige Lust, da sie aber auf Empfindung beruht, ist auch sie letztlich sinnlich.
Wenn die Mittel zum Leben in einer so bestimmten Lust leicht zu verschaffen sind, so ist damit die Verfügbarkeit des Glücks noch keineswegs garantiert; denn es gibt Faktoren, die das Gefühl eines runden Wohlergehens unmöglich zu machen scheinen. Es sind dies die Empfindungen von Furcht, Begierde und Schmerz. Nur wenn sich diese Quellen von Unlust ausschalten lassen, ist das bescheidene Glück des Epikureers verfügbar. Manche Furcht lässt sich durch Vorsichtsmaßnahmen oder rationale Erklärung beheben. Wie aber ist es mit der Furcht vor dem Tod und der Furcht vor der Übermacht der Götter? Hier hilft Aufklärung. In beiden Fällen ist Furcht unangebracht. Wenn sich mit dem Tod des Leibes zugleich die Seele auflöst, gibt es keine Wahrnehmung von ihm. Wie soll uns etwas, das nicht wahrnehmbar ist, Furcht einflößen? Bekannt ist das Diktum Epikurs aus dem Menoikeus-Brief (125): „Das schaurigste aller Übel, der Tod, geht uns nichts an, denn solange wir sind, ist der Tod nicht da, wenn aber der Tod da ist, sind wir nicht mehr.“ Auch für die Furcht vor den Göttern gibt es keinen Grund. Zwar existieren sie nach Epikur, aber es wäre mit ihrem Begriff, selige Wesen zu sein, unvereinbar, wenn sie sich mit einer Weltregierung abmühen würden. Sie leben selig in jenseitigen Zwischenwelten und haben nur die Funktion, von uns als Vorbilder eines Lebens in ungetrübter Lust verehrt und nachgeahmt zu werden. Begierden müssen keine Quellen von Unlust sein, sofern man einsieht, dass es nicht darauf ankommt, immer mehr „Objekte“ ihrer Befriedigung herbeizuschaffen, sondern darauf, Ansprüche auf das Notwendige zu reduzieren. Ein Satz Epikurs lautet: „Wenn du jemanden reich machen willst, gib ihm nicht mehr Geld, sondern nimm ihm von seiner Begierde.“ Ein anderer: „Nichts ist ausreichend dem, dem das Ausreichende zu wenig ist.“ Wie steht es mit dem Schmerz? Vor der Entdeckung einer hochwirksamen Anästhesie, war er unvermeidbar. Also bleibt nur die Möglichkeit, in einer bestimmten Weise mit ihm umzugehen, so nämlich, dass er das Leben in der Lust nicht gänzlich zu überwältigen vermag. Manchen Schmerz (die bittere Pille) wird man in Kauf nehmen, wenn dadurch größere Lust zu erreichen ist. Mancher mag erträglicher werden, wenn man gleichzeitig durch eine Lusterfahrung von ihm ablenkt. Eine Kompensation ist auch möglich durch Erinnerung an frühere und Erwartung späterer Lust. Schließlich können Schmerzen auch erträglicher werden, wenn man sie richtig einschätzt: „Entweder die Zeit oder das Leid ist klein.“ D.h.: Chronische Schmerzen sind nicht so stark, starke führen bald zum Tod. (Cicero: Si gravis brevis; si longus levis.) Ob das den Betroffenen wirklich hilft? Epikur hat es in seinen qualvollen letzten Stunden versucht (vgl. sein Brief am Todestag).
Neben den negativen Verfahren, Unlustquellen soweit als möglich auszutrocknen, gibt es positive, die das Glück der Lust herbeizuführen bzw. zu sichern vermögen; es sind dies Tugend, Freundschaft und Staat. Tugend ist bei Epikur nicht Selbstzweck. Würde sie nicht zur Lust führen, wäre sie nichts wert. Gleichwohl ist die Verbindung zwischen beiden sehr eng: Kein lustvolles Leben ohne Tugend, denn ohne Tugend befände sich die Seele in innerer Zwietracht, die ruhiges Erleben von Lust verhindert. Die Entfaltung der Tugend in den traditionellen vier Kardinaltugenden (epikureische Reihenfolge: Weisheit im Sinn von Klugheit, Besonnenheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit) zeigt, was sie zur Einstimmigkeit beiträgt. Nur auf die Gerechtigkeit sei hier nochmals der Blick gelenkt. Sie besteht für Epikur lediglich in der Befolgung geltender Gesetze. Wer gegen sie verstößt, zieht sich vermeidbare Unlust zu, eine Unlust, die nicht verschwindet, weil er stets befürchten muss, sein ungerechtes Handeln werde eines Tages doch noch entdeckt. Besondere Wertschätzung genießt bei Epikur die Freundschaft. Da immer missliche Umstände (z.B. Krankheit) vorstellbar sind, die man alleine nicht bewältigen kann, bedarf es eines auf persönlicher Zuverlässigkeit beruhenden sozialen Netzes, um Unsicherheit und somit Unlust zu vermeiden, d.h. der Freundschaft. Freundschaft wird zwar um der Sicherung lustvollen Lebens willen gesucht, besteht sie aber einmal, dann ist sie selbst eine Quelle von Lust. Wozu dann der Staat? Über die Binnenbeziehung der Freundschaft hinaus gibt es viele Menschen, von denen Unsicherheit ausgeht. Sie müssen nicht schädigen, allein dass sie es könnten, bereitet Furcht und beeinträchtigt damit ein ruhiges, glückliches Leben. Soll das „natürliche Gut“ der Sicherheit gewährleistet werden, gilt es, durch einen Vertrag Rechtsverhältnisse herzustellen. „Das von Natur Gerechte ist eine Vereinbarung (symbolon) über das, was dazu beiträgt, einander nicht zu schädigen noch geschädigt zu werden.“ (Hauptlehren 31; vgl. eine solche Vertragstheorie schon bei Platon, Staat 358e – 359b) Da es Recht und Gerechtigkeit nur auf der Grundlage eines solche Vertrages gibt, sind alle Lebewesen, die keine Vertragspartner sind oder sein können, von Recht und Gerechtigkeit ausgeschlossen (vgl. Hauptlehren 32). So etwas wie allgemeine Menschenrechte (wie in der Stoa und – prinzipiell – im Christentum) oder gar ein in den letzten Jahren viel diskutiertes Recht von Tieren gibt es bei Epikur offensichtlich nicht.
Nicht der schlechteste Weg zum glücklichen Leben ist es, sich an weise Ratschläge zu halten. Zwei davon wurden oben zitiert, ein allseits bekannter lautet (in der Fassung von Horaz): Carpe diem! Wie wird er treffend übersetzt?