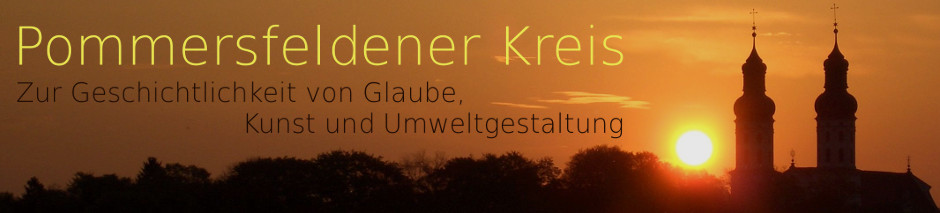Kappacher, *1939, aufgewachsen in sehr bescheidenen Verhältnissen in der Nähe Salzburgs, lebt seit 1978 als freier Autor.
Nach der 8-klassigen Volksschule war er in der ersten Phase seines Berufslebens als Motorradmechaniker tätig, ab 1960 als Angestellter in Reisebüros, dazwischen für kurze Zeit Schauspielschüler. In dieser Phase hat sich seine Leseleidenschaft vertieft, und er hat begonnen zu schreiben. Einblicke in seinen Lebensweg bis ca. 1960 gibt, neben verschiedenen Selbstzeugnissen, der autobiographische Roman "Ein Amateur", 1993.
Gegenstand seines realistischen Schreibens ist das gewöhnliche Leben, meist das von Angestellten, (vgl. seinen Roman "Morgen", 1975, sowie die längere Erzählung "Rosina", 1978), aber auch das eines Ausnahmemenschen, des Schriftstellers H. (gemeint ist Hugo von Hofmannsthal) in "Der Fliegenpalast", 2009. Erzählt wird stets aus der Erfahrungsperspektive der Protagonisten, und zwar in Episoden, die nicht chronologisch angeordnet sind und dem Leser Luft geben, selbst die Bedeutung der Episoden für Bewusstsein und Entwicklung der "Helden" einzuschätzen.
Unter Berufung auf die Laudatio von Peter Handke anlässlich der Verleihung des Hermann-Lenz-Preises an Kappacher im Jahre 2004 wird dessen Schreiben näher charakterisiert: Es ist von großer Ernsthaftigkeit gekennzeichnet, der Ernst ist aber ein beiläufiger, kein sich ausstellender. Handke vergleicht Kappachers Erzählweise mit einer Oper, die fast nur aus Rezitativen besteht, die den Hintergrund ausleuchten und "Anläufe" zu ein oder zwei Arien bilden, Passagen, in denen "der Autor sein Innerstes ausschwingen lässt" - bzw. das seiner Figuren. Deutlich wird immer, wie lang und wenig steuerbar der Weg zum Ich ist, "auf einmal" finden die in der Tiefe brodelnden Kräfte eine Richtung auf der Suche nach einem Weg aus dem als fremd erfahrenen eigenen Leben. Niemals erhebt sich der Autor über seine Protagonisten, sondern gibt sich als "Feind seiner eigenen Lebensart" zu erkennen und dem Leser durch diese Erzählhaltung Raum, sich selbst und den anderen als Fremden zu sehen: Kappacher öffnet unseren Blick für uns selbst und für andere und dafür, wie wenig vertraut wir mit uns und einander sind.
In "Selina oder das andere Leben" (2005) wird in 61 Episoden aus der Perspektive von Stefan, einem Lehrer im Sabbatjahr, erzählt, wie er für einige Sommermonate auf einem verfallenen Landgut in der Toskana lebt und dort vorübergehend ein "anderes Leben" findet. Dieser Roman war Kappachers erster größerer Erfolg. Dieser Erfolg lässt sich einmal zurückführen auf die sehr anschauliche, realistische Erzählweise (die sich auch aus vergleichbaren Erfahrungen des Autors erklärt), dann der Anziehungskraft des Ortes und der Landschaft, in der Stefan für drei Monate lebt, entscheidender aber noch auf das Lebensgefühl des Protagonisten, der nie das Gefühl hat, etwas zu versäumen, der ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit gewonnen hat, als das, was seinen gewöhnlichen Alltag und wohl auch den des Lesers bestimmt.
In einem kaum wahrnehmbaren, deshalb schwer zu charakterisierenden Erzählstil wird in sachlich-feststellendem Ton das Bild eines "anderen Lebens" mosaikartig zusammengesetzt. Die Erzählhaltung Kappachers erinnert an die Stifters: sie folgt dem von Stifter postulierten "sanften Gesetz", das Natur und Menschen auf dem gleichen Rang existieren lässt.
Das "Hintergrundleuchten" dieses Romans bilden die weiten Passagen, in denen Stefans Handwerk zum Leben, auch das gewöhnliche Leben der Einheimischen und der Beistand, den sie Stefan leisten, sowie dessen Landschafts-, Natur- und Himmelsbeobachtungen dargestellt werden. Diese "Rezitative" schwingen sich gelegentlich auf zu "Arien", in denen Momente intensiver Wahrnehmung beim Schauen in die Landschaft und den Sternenhimmel geschildert werden.
Der Roman vermittelt auch ein anschauliches, keineswegs idealisierendes Bild des Lebens der Landbevölkerung in den 80er Jahren in der beschriebenen Region der Toskana, eines Lebens, in das der Tod noch selbstverständlich einbezogen ist. Stefan macht hier die Erfahrung des "Einander-Gelten-Lassens", die ihn sich hier mehr als daheim zu Hause fühlen lässt.
Wichtig für den Protagonisten ist auch die Auseinandersetzung mit Kunst und Literatur, für beides hat er hier Zeit, insbesondere für das Betrachten von Fresken und Gemälden aus der Renaissance und für die Lektüre klassischer Texte zu Fragen der Lebensführung, bei beidem schätzt er deren Ernsthaftigkeit und Unsentimentalität.
Im Unterschied zu den Protagonisten früherer Texte Kappachers hat der Held dieses Romans trotz aller Distanz und nur weniger Begegnungen einen Gesprächspartner, ein Du, gefunden, auf das er sich in seinem Denken und Erleben immer wieder bezieht, und zwar in Seiffert, der ihm das Landhaus zur Verfügung gestellt hat, allerdings am Ende von Stefans Aufenthalt stirbt. Die Gespräche zwischen beiden gipfeln in einem "Gespräch über Tod und Unsterblichkeit", in dem Seiffert Stefan auf Jean Pauls Roman "Selina oder Über die Unsterblichkeit der Seele" hinweist. In den Diskursen dieses Romans hielten die Protagonisten "Antennen für Übersinnliches" offen, eine Haltung, die dem Leben Tiefendimension verleihe.
Höhepunkt des Romans ist die Schilderung einer "Schreckensnacht", in der für Stefan vom Sternenhimmel plötzlich ein ungeheurer Sog ausgeht, der ihn seine Bedeutungslosigkeit im All, die Nichtigkeit seines Lebens spüren lässt. Im alltäglichen Tun und in der Erinnerung an starke Glücksempfindungen angesichts des Sternenhimmels, die er auch in Mora erlebt hat, erholt er sich jedoch von der tiefen Verstörung und wünscht sich, dem Nichts unerschrocken ins Auge blicken zu können.
Die Titelfigur Selina ist die Nichte Seifferts, der Stefan viermal begegnet. Er verliebt sich in sie - sie kehrt aber mit ihrem Mann nach Deutschland zurück und es bleibt ungewiss, ob Stefan sie jemals wiedertreffen wird. Wieder im Unterschied zu anderen Texten Kappachers werden in "Selina" einige Momente intensiver Begegnung von zwei Menschen geschildert - die in Stefan vielleicht die Möglichkeit eines "anderen Lebens" mit Selina aufscheinen lassen.
Kappachers "Poetik stützt sich auf Wahrnehmung, Hinschauen, Geltenlassen" , wie Paul Ingendaay es in seiner Lobrede zum Büchnerpreis formuliert hat, und dies gilt sicher insbesondere für seinen Roman "Selina oder das andere Leben" - sein wichtiges Werk auf dem Weg zum Büchnerpreisträger.