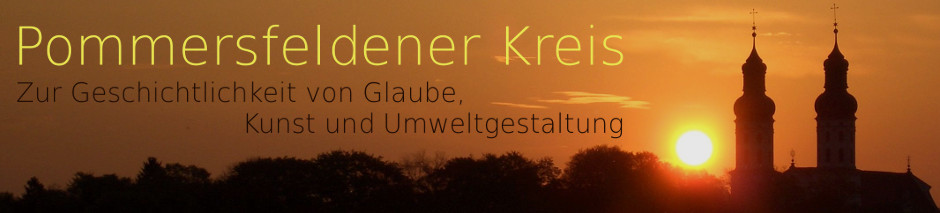Ausgehend von zeitgenössischen Äußerungen (Hoche 1801), dass Gebetbücher moderne Glaubenseinsichten vermittelten, stellte sich die Frage, wie Religion mit dem Fortschritt der europäischen Neuzeit umgeht, auf Modernisierungsprozesse unter dem Einfluss der Aufklärung reagiert. Anhand konkreter Beispiele war aufzuzeigen, was „katholische Aufklärung“ ist. Wie lässt sich die von Gott den Menschen geoffenbarte Weisheit mit der Forderung der Aufklärer vereinbaren, alles in der Welt am Maßstab der menschlichen Vernunft, der ratio, zu messen, zu prüfen und falls nötig zu verbessern?
Nun ist das Gebet als die Zwiesprache des Einzelmenschen mit Gott eine sehr persönliche und private Sache. Doch sind die Texte in einem Gebetbuch nicht die realen Gebete eines Gläubigen, sondern es sind Bethilfen eines theologisch gebildeten Autors, der Texte vorbetet und – im doppelten Sinne: vorschreibt. Mit diesen Gebetbüchern erfasst man also mehr die Norm als die Realität. Die Funktion eines Gebetbuches beschrieb der Reformtheologe Michael Wecklein (1777 – 1849) 1805 so: „ Das Gebethbuch ist gleichsam der beständige Gefährte des gemeinen Mannes, den er zuhause und in der Kirche, beym Tag und bey der Nacht bey sich hat; von dem er fast allein seine religiösen Sitten, Lehr- und Denkweise annimmt ...“ Daraus folgte für Wecklein die Notwendigkeit strenger Kontrolle. Tatsächlich bedurften diese Bücher – wie eigentlich alle theologischen Texte – der kirchlichen Genehmigung. Was empfiehlt eine für Modernisierung eintretende kirchliche Obrigkeit für die Gläubigen?
Ältere Gebetbücher, geschrieben im Geist der Katholischen Reform, fordern die pausenlose Hingabe an Gott, ein stetes Mitbedenken des Göttlichen in allem Tun, auch zur Handlungs-kontrolle. Modernere Gebetbücher betonen gegenüber dem mechanischen Vollzug der Gebete die Innigkeit des Lesens, das Verstehen und denkerische Durchdringen des Gelesenen. Dafür müsse man sich Zeit nehmen und diese aus dem Alltag aussondern – also eben nicht die ständige Durchdringung des Alltags mit religiösen Gedanken, sondern die Ausdifferenzierung der Gebetszeiten wird gefordert. Das Nachdenken bedeutet auch Nachdenken über das eigene Handeln – in Bezug und für den Mitmenschen. Damit wächst die Verantwortlichkeit des Einzelmenschen. Das Interesse der Obrigkeit war, dass die Menschen sich selbst regierten – aber eben nach den vorgegebenen Maßstäben.
Auch Gebetbücher können also aktuelle, moderne Gedanken transportieren, aber Voraussetzung ist, dass sie von Staat und Kirche erwünscht sind oder zumindest toleriert. Gebetbücher entstanden nicht im luftleeren oder geschichtslosen Raum einer absoluten Wahrheit, sondern sie orientieren sich auch an dem, was obrigkeitlich gewünscht wird einerseits und andererseits an dem, was für das Publikum akzeptabel war – um es modern zu sagen, man holte den Gläubigen dort ab, wo er im Leben stand. Und man staunt, was dort alles möglich war.