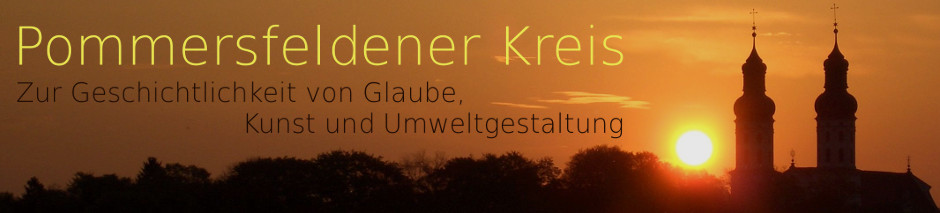Der an zwei Terminen stattfindende Vortrag gliederte sich nach den vier Sätzen, um die es im klassischen Streichquartett geht, und zwar in der Reihenfolge Kopfsatz, Menuett (1. Termin), Langsamer Satz und Schlusssatz (2. Termin).
An zwei vorweg behandelten Beispielen wurden zunächst zwei den Schematismus der sog. Sonatenhauptsatzform unterlaufende unterschiedliche Analyseansätze durchgespielt. Die Form des ersten Satzes von Mozarts frühem Streichquartett G-Dur, KV 156 wurde primär als periodisch gegliederter Ablauf, der 1. Satz des Quartetts op. 33,2 von Joseph Haydn als Prozess thematischer Arbeit dargestellt. Beide Gesichtspunkte verbanden sich dann in der Betrachtung des Kopfsatzes des Streichquartetts C-Dur, KV 465, von Mozart (1785).
Die harmonischen Merkwürdigkeiten in der Einleitung dieses sog. »Dissonanzenquartettes« ließen sich als bewusste Regelverstöße mit der Absicht einer Exposition des Gegensatzes von Chaos und Ordnung interpretieren. Im Allegrosatz selbst ging es darum zu zeigen, wie musikalische Form bei Mozart durch Entfernen vom und Wiederanknüpfen am Thema entsteht.
Die Betrachtung des zur viersätzigen Form gehörigen Tanzsatzes (Menuett mit Trio) untersuchte Mozarts Umgang mit den Gesetzmäßigkeiten der Phrasengliederung. Dies geschah am Beispiel des Menuetts des Quartetts C-Dur, KV 170 (1773) und des knapp zehn Jahre später entstandenen Trios g-moll des Quartetts G-Dur, KV 387. In beiden Fällen macht Mozart einen kleinen Einschub in den ansonsten regelmäßig gegliederten Zusammenhang. Während dies im frühen Stück nur ein anmutiges Spiel von Unterbrechung und Wiederanknüpfung auslöst, gehen im späteren Stück die harmonischen und formalen Auswirkungen einer zunächst minimalen Überschreitung des Regelmaßes weit über das hinaus, was die Konvention von einem Satz tänzerischen Charakters erwartete.
Vor der exemplarischen Interpretation eines Langsamen Satzes aus Mozarts Streichquartetten der 80er Jahre waren zwei Voraussetzungen für das Verständnis zu schaffen: An einem Beispiel aus Joseph Haydns op. 33 wurde darauf aufmerksam gemacht, dass im reifen klassischen Stil auch instrumentale Begleitfiguren zum Gegenstand thematischer Arbeit geworden sind. Ein anderes Beispiel aus einem frühen Quartett Mozarts belegte die Bedeutung der vokalen Arie für die Ausbildung des Langsamen Satzes in der klassischen Instrumentalmusik. Anschließend war im Andante des 1783 entstandenen Quartetts KV 421 die Integration von genuin vokaler und genuin instrumentaler Stilistik in einem komplexen Ganzen nachzuvollziehen.
Mit dem Rondo-Finale des frühen Streichquartetts KV 155 wurde der Idealtypus eines Schlusssatzes für ein divertimentohaftes Stück vorgestellt. Ihm folgte die vierstimmige Fuge, die das Streichquartett F-Dur, KV 168 beendet. Mozart zeigt sich hier abhängig von Joseph Haydn, der in in seinem Bemühen, den Divertimentocharakter des Streichquartetts zu überwinden, in seinem kurz zuvor herausgekommenen Quartettzyklus op. 20 mit solchen Schlussfugen experimentiert hat.
Auf der Basis einer verfeinerten Meisterschaft in der thematischen Arbeit verfügte Joseph Haydn in seinen neun Jahre später herausgekommenen Streichquartetten op. 33 wieder sehr frei über die Formen auch des Schlusssatzes. Mozart, der auf Anregung eben dieses op. 33 in den Jahren 1782 - 1785 sechs Streichquartette komponierte – und sie Joseph Haydn widmete - blieb dem kontrapunktischen Stil dabei stärker verhaftet als sein älterer Freund. Seine Kontrapunktik war aber jetzt keine stilistische Anleihe bei der Barockmusik mehr, wie das noch vom Finale von KV 168 gesagt werden kann, sondern eine stilistisch integrierte, je nach der musikalischen Dramaturgie des Werks jederzeit wieder in Homophonie rückführbare Verdichtung des Bezugs, den die Stimmen im klassischen Satz zueinander haben, und für den Beethoven den Begriff des »obligaten Accompagnements« gebraucht hat.