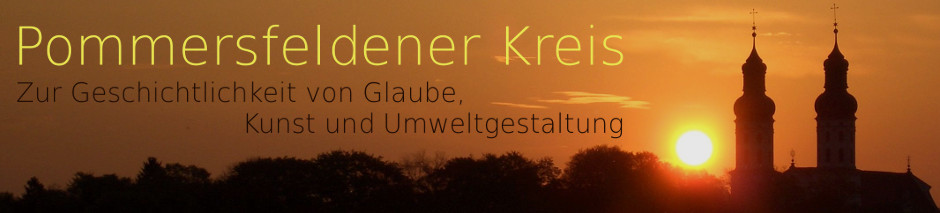Ziel des Vortrages war es, anhand der Entwicklung der philosophischen Konzeption der »inneren Sinne« einen Einblick in die die arabische Tradition griechischer Philosophie, Medizin und Wissenschaft zu bieten.
Als Ausgangspunkt diente im ersten Teil Avicennas (980–1037) einflussreiche Lehre von fünf inneren Sinnen, welche die auf Sinneswahrnehmung aufbauenden geistigen Funktionen wie Vorstellung, Gedächtnis, diskursives Denken vertreten und eine Mittlerstellung zwischen sinnlicher Wahrnehmung und Intellekt einnehmen. Anders als die äußeren Sinne haben die inneren Sinne (Gemeinsinn, Einbildungsvermögen, vorstellendes / denkendes Vermögen, Einschätzungsvermögen, Erinnerungsvermögen) kein körperliches Organ; ihre Funktion werden durch den »animalischen Geist« ausgeführt. Sie haben jedoch einen Sitz im Körper: die Ventrikel des Gehirns.
Wie im zweiten Teil des Vortrags festgestellt wurde, gab es jedoch konkurrierende Versionen dieser Lehre: Averroes (1128–1198) beschränkt sich auf vier Vermögen (Gemeinsinn, Einbildungsvermögen, Denkvermögen, Erinnerungsvermögen) und vermeidet die Bezeich-nung »innere Sinne«; Thomas von Aquin folgt ihm in der Zahl der Vermögen, aber nimmt Avicennas Einschätzungsvermögen unter diese auf.
Um Ursprung und Hintergrund dieser Unstimmigkeiten zu klären, wurden in den verbleibenden drei Teilen des Vortrags die Quellen der »inneren Sinne« in den Blick genommen. Unter den antiken und spätantiken griechischen Quellen (dritter Teil) sind neben der aristotelischen Seelenlehre vor allem anatomische Lehren zu nennen, die durch die Schriften Galens, aber auch durch Autoren wie Nemesius von Emesa verbreitet wurden, und die die drei geistigen Vermögen der Einbildungskraft, des Denkens und des Gedächtnisses in den Hirnventrikeln verorteten.
Arabischen Autoren des 9. und 10. Jahrhunderts waren diese Lehren aus Übersetzungen (Aristoteles, Galen, Nemesius u.a.) bekannt (vierter Teil). Auffällig an der Entwicklung im arabischen Bereich ist, dass sich nicht nur bei Avicenna, sondern auch bei anderen Autoren fünf innere Sinne finden, während die »galenischen« Vermögen nur drei oder vier zählen (unter Zuzug des Gemeinsinns). Dies scheint außerdem mit der Umbennenung von »geistigen Vermögen« zu »inneren Sinnen« einherzugehen. In diesem Zusammenhang ist die arabische Adaption der Aristotelischen Parva Naturalia (9. Jhdt.) von Bedeutung. In diesem Text, der Bruchstücke des Aristotelischen Textes mit neuplatonischem und spätantikem medizinischem Material vereint, werden die »galenischen« Vermögen (zusammen mit dem Gemeinsinn) vor allem in ihrer Funktion als Empfänger göttlich offenbarter Wahrträume dargestellt, und im Rahmen eines Körper-Geist-Dualismus der geistigen Welt zugeordnet. Der Text, der Avicenna, Averroes und anderen als Quelle gedient haben wird, lässt in mehreren Punkten Ansätze der Entwicklung zu Avicennas System hin erkennen, erklärt aber gleichzeitig, warum der Aristoteliker Averroes auf vier geistigen Vermögen bestanden hat.
Im fünten Teil des Vortrags wurde darauf hingewiesen, dass im 9. und 10. Jhdt. im gleichen geographischen Raum auch andere Vorstellungen von fünf »inneren Sinnen« bekannt waren, die mit den »galenischen« Vermögen und der Verarbeitung von äußeren Wahrnehmungen nichts zu tun haben. Sie finden sich sowohl in christlicher Theologie (in der Nachfolge von Origenes), als auch in graeco-arabischen oder syrischen Texten mit neupythagoreischem oder geheimwissenschaftlichem / gnostischem Hintergrund. Wie die arabischen Parva Naturalia betonen sie die Fähigkeit der inneren Sinne, die höhere Welt wahrzunehmen. Die Präsenz solcher Vorstellungen könnte, in Verbindung mit der arabischen Version der Parva Naturalia, Anstöße zu der Entwicklung von Konzeptionen von fünf inneren Sinnen gegeben haben.