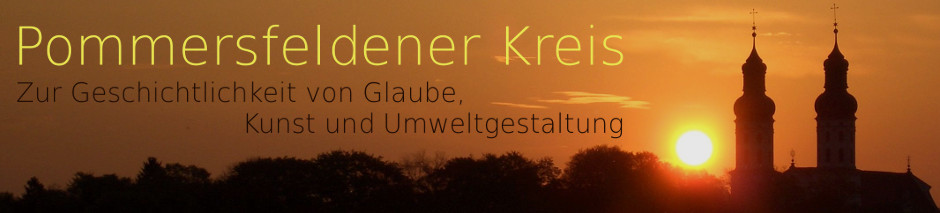Klaus Blesenkemper: Kant als moderner Didaktiker
Im ersten Teil seines Vortrags entfaltet der Autor unter drei „K’s“ drei zentrale Kriterien für „modernen Unterricht“: Die heutige Didaktik geht als Allgemeine Didaktik wie auch als Fachdidaktik Philosophie von einer konstruktivistischen Lerntheorie aus. Im Gegensatz zu veralteten ‚Trichtertheorien’ ist im Sinne des ersten „K’s“ der Lernprozess als im Wesentlichen aktives Geschehen seitens des Lernenden zu begreifen. Nach dem Maßstab der „Viabilität“ konstruiert er mit seinen Mitschülern seine Sicht auf die Wirklichkeit, die damit immer seine Wirklichkeit ist. Problemorientierung und Schüleraktivierung sind daraus resultierende didaktische Maximen. Konstruktion wird hier nicht im Sinne eines radikalen Konstruktivismus begriffen, sondern als sozial vermittelte bzw. interaktionistische Ko-Konstruktion. Entsprechend werden heute - das meint das zweite „K“ - kooperative Lernformen, etwa nach dem Muster „think, pair, share“ bevorzugt. Um zu berücksichtigen, dass sich heute die relevanten Wissensbestände in immer kürzerer Zeit überholen, werden gegenwärtige Bildungsziele als kompetenzorientiert gefasst. Es soll dabei um die Befähigung zu Problemlösungen in wechselnden Situationen gehen. Was aber genau unter Kompetenz - das dritte „K“ - zu verstehen ist, ist in der bildungspolitischen und didaktischen Fachdiskussion noch sehr umstritten.
Die zentrale Vortragsthese lautete: Kant hat bereits in seinen explizit und implizit didaktischen Überlegungen wichtige Grundlagen einer so verstandenen modernen Didaktik vorformuliert und grundgelegt. Als Begründung der These dienen zum einen die weithin bekannten didaktischen Passagen aus Kants Vorlesungsankündigung für das Wintersemester 1765/1766 wie auch auf entsprechenden Stellen aus der Kritik der reinen Vernunft. Danach weist Kant die Anmaßung zurück, man könne „Philosophie“ lernen. Möglich (und nötig) zu lernen sei vielmehr das „Philosophieren“. Dieses Prinzip bringt fachdidaktisch zur Geltung, was Kant mit seinem „sapere aude“ allgemein unter Aufklärung versteht. Wichtiger noch als die direkte Aufforderung Kants, man solle philosophieren lernen, wertet der Autor drei Maximen Kants als didaktisch relevant und aktuell. Diese im Kantischen Schrifttum mehrmals begegnenden Maximen sind bedeutsam, denn sie gelten etwa als „Allgemeine Regeln und Bedingungen der Vermeidung des Irrthums“ oder gar als „unwandelbare[.] Gebote[.]“ „[f]ür die Klasse der Denker“. Sie lauten: „1. Selbst denken. 2. Sich (in der [Gemeinschaft] Mitteilung mit Menschen) in die Stelle jedes anderen zu denken. 3. Jederzeit mit sich selbst einstimmig zu denken.“ Die erste Maxime, die dem ersten „K“ entspricht, fügt sich problemlos in den unter anderem durch die Kopernikanische Wende begründbaren Aufklärungsimpuls „sapere aude“. Die zweite Maxime ist weit weniger selbstverständlich, denn sie rekurriert auf die Intersubjektivität der Vernunft, die dieser mit Blick auf Kant häufig abgesprochen wird. Er aber verweist ausdrücklich auf den Dialog als Mittel zur Vermeidung von Irrtümern und legitimiert damit implizit kooperative Lernformen. Noch weniger wird, so eine These des Autors, die dritte Maxime angemessen gewürdigt. Vielfach wird sie lediglich als Aufforderung zu logischer Konsistenz verstanden. Als Maxime der „Vernunft“ ist sie aber weit mehr als eine Aufforderung zur Persönlichkeitsbildung bzw. zur – wohl verstandenen – Kompetenzbildung zu interpretieren.
Friedrich A. Uehlein: Wolfram von Eschenbach, Willehalm
Zur Vorbereitung waren die zweisprachigen Ausgaben von Dieter Kartschoke (Berlin 21989) und Joachim Heinzle (Frankfurt a. M. 1991) empfohlen worden, sowie die Einführung von Kurt Ruh (Höfische Epik des deutschen Mittelalters, 2. Teil, Berlin 1980, S. 154 – 196). Heinzles Ausgabe enthält einen umfänglichen Kommentar. Joachim Bumke hat sein Buch Wolfram von Eschenbach in der Sammlung Metzler seit 1964 ständig erweitert. In der 8. Auflage von 2004 umfaßt seine Darstellung und die kritische Durchsicht der Literatur die Seiten 276 – 406. Die Textausgaben und die genannten Einführungen räumen die Barrieren beiseite, die für die Lektüre eines mittelhochdeutschen Romans zu befürchten sind.
Wir begannen unmittelbar mit dem Prolog des Willehalm. Wolfram bearbeitet im Auftrag des Landgrafen Hermann von Thüringen ein Kapitel aus der französischen Nationalgeschichte: die Chanson de geste Bataille d’Aliscans, die den siegreichen Kampf Wilhelms von Orange über die Sarazenen schildert. Indem Wolfram auf den Parzival anspielt (und seine Aufnahme beim Publikum), wird deutlich, daß er mit dem Willehalm etwas Neues vorhat, nicht nur einen neuen Roman, sondern eine neue Art von Roman in der deutschen Literatur seiner Zeit. Es geht nicht mehr darum, die Artuswelt und die Gralsgeschichte neu zu realisieren, Chrétien de Troyes zu folgen und mit Hartmann von Aue und Gottfried von Straßburg zu konkurrieren, er muß vielmehr einen geschichtlichen Stoff bewältigen, der einen anderen Wahrheitsanspruch erhebt und ihn in anderer Weise verpflichtet als die Stoffe des höfischen Romans.
Nacherzählung: Lektüre ausgewählter Stellen (mittelhochdeutsch und neuhochdeutsch) und Interpretation folgten dem Gang des Romans: Erste Schlacht von Alischanz und Vernichtung des christlichen Heers (Bücher I & II) Willehalm entkommt, ertrotzt und erkämpft sich die Hilfe seiner Sippe und ein Reichsheer von König Ludwig (III & IV); Giburg, seine Frau, verteidigt unterdessen Orange gegen ihre eigene Sippe und das Invasionsheer (V & VI); Zweite Schlacht von Alischanz, Niederlage und Abzug der Invasoren (VII & IX). Neben den Hauptakteuren beider Parteien wurden die Protagonisten beider Schlachten, Vîvîans und Rennewart, ausführlicher behandelt. (Wie wird eine Figur zu einem Charakter?) Ferner Ausführungen zur epischen Technik Wolframs — wie stellt er das bewegte, wechselnde Schlachtgeschehen dar? — und zu den komisch bizarren Einsprengseln und dem comic relief.
Im Fortgang der Interpretation wurde der Unterschied zum höfischen Roman gezeigt und wie Wolfram seinen Auftrag erfüllt. Das Heldenepos aus dem Zyklus um Wilhelm von Orange ist auf die Vorgänge und die Überwindung der feindlichen Sarazenen konzentriert. Wolfram reflektiert das Geschehen. Er durchsetzt es mit Einwürfen, Überlegungen und Kommentaren des epischen Erzählers. Das Geschehen und das Handeln der Personen werden ihm zum Problem. Er fragt — durch die Art und Weise, wie er erzählt — nach dem Sinn der vorgegebenen historischen Vorgänge. Von größter Bedeutung ist dabei der Anfang des Prologs, mit dem wir unmittelbar begonnen haben (1,1 – 2,22). Die Anrufung es Dreieinen [dû drî unt doch einer], des Schöpfers [schepfaere über alle geschaft] und Erlösers [dîn kint und dîn künne / bin ich bescheidenlîche] gibt dem Roman den Horizont. In diesem Horizont werden die Liebe von Giburg und Willehalm, Treue und Treulosigkeit, Rittertum, Minne und Haß, Pracht und Verfall der Großen, Rachsucht und unbändige Wut, Freundestreue bis in den Untergang und das Gemetzel der Schlachten [diu mac vür wâr wol heizen mort 10,20], die Verteufelung des Feindes und gegenseitige Anerkennung, unterschieden und erfaßt. In diesem Horizont erscheinen beide Parteien, die heidnische und die christliche, miteinander. Beider Recht und Unrecht, Größe und Leid werden dargestellt und reflektiert. Giburgs Rede vor der zweiten Schlacht (306 – 310) wurde in Ausschnitten gelesen und eingehend besprochen. In der schlimmsten Verhärtung — sus râche wider râche wart gegeben (305,30) — vermag sie Christen und Sarazenen aus der unversöhnlichen Feindschaft zu lösen und als Gleiche zu sehen [gotes hantgetât 306, 28; 450, 19]. Ihre Sicht konkretisiert, jetzt am Abend vor der Schlacht, den Horizont, den der Prolog entworfen hat. Freilich vermag die Wahrheit ihrer Sicht die Schlacht nicht zu verhindern, aber eine Rechtfertigung der Schlacht und des Krieges (und sei’s um der Religion willen), ist unmöglich.
Wolfram hat das Epos nicht vollendet. Es endet in den vorliegenden Handschriften bedeutsam genug mit einer Szene gegenseitiger Anerkennung. Wir sehen Willehalm nach der Schlacht in Verhandlung mit dem vorbildlichen König Matribleiz von Gaheviez. Er löst ihn und seine Gefährten aus der Gefangenschaft, stellt ihm Leute und Muli zur Verfügung und bittet ihn (466,1), die toten heidnischen Könige in die Heimat zu überführen, damit sie dort nach ihrer eigenen Religion und Sitte würdig bestattet werden [dâ man si schône nâch ir ê / bestate (465,19)]. »Ich empfehle euch, König Matribleiz / dem, der die Menge der Sterne zählt / und uns das Licht des Mondes gab. / Ihm seid anempfohlen, / er bringe euch heim. / Ritterlicher Sinn wich nie aus eurem Herzen« (466,29 – 467,4).
Gerhard Wilflinger: Erinnern – Verdrängen – Vergessen. Geschichte und Vergangenheitspolitik
Gerhard Wilflinger ist am 25. 7. 2013 gestorben. Die Kurzfassung seines Referats erfolgt in Stichworten nach dem Manuskript:
Ausgangspunkt der Überlegungen ist: die Erinnerung an historische Fakten und wie sie gedeutet und geschichtsmächtig oder verdrängt werden. Beispiele dazu waren die Schlacht auf dem Amselfeld 1389 (im südwestlichen Balkan, auf serbisch Kosovo Polje, in der das serbische Ritterheer von den Türken vernichtet wurde, und die bis zu den letzten Balkankriegen die Konflikte schürte und auslöste); die historische Fiktion, Mazedonien sei seit Alexander dem Großen „griechisch“ gewesen (Griechenland verhinderte den Staatsnamen Mazedonien in der EU); die Leugnung der Briten, für den Massenselbstmord der Donkosaken in Kärnten 1945 mitverantwortlich gewesen zu sein, und die Leugnung des versuchten Genozids an den Armeniern durch die türkischen Regierungen.
Diese Beispiele zeigen, was alles aus „Fakten“ werden kann, weil sie zu dem gehören, was wir als Geschichten erzählen und weitergeben: sie sind mehrdeutig, von Interessen geprägt, und haben die Funktion, der Welt eine Sinnstruktur zu geben, sie zu einer erzählbaren Welt zu machen, der die Menschen sich zugehörig wissen.
Das historische Bewusstsein gehört zum Menschen. Damit sie aber auch Menschen bleiben, sollen sie reflektierend Distanz zur den erzählten Geschichten gewinnen.
„Niemals vergessen“ ist eine Parole, die mit hohem moralischem Anspruch einhergeht. Was besagt sie, was sind ihre unreflektierten Auswirkungen? Die These, das Nicht-Vergessen verhindere spätere Konflikte, Verbrechen, Kriege kann sich – so zeigen die Überlegungen - weder auf eine theoretische Begründung noch auf historische Erfahrungen berufen. Das Vergessen kann, im Gegenteil, heilend sein und wird deshalb auch eingefordert. Beispiele u.a. sind die Rede Ciceros nach der Ermordung Cäsars („Alle Erinnerungen an die mörderischen Zwistigkeiten sind durch ewiges Vergessen zu tilgen“) und der Westfälische Friedensschluss 1648 („alle Beleidigungen, Gewalttätigkeiten, Schäden und Untaten sollen gänzlich abgetan sein, dass alles in ewiger Vergessenheit begraben sei“). Nicht appellativ sondern grundsätzlich in Kants Schrift vom Ewigen Frieden: „Dass mit dem Friedensschluss auch die Amnestie verbunden sei, liegt schon im Begriff desselben“.
„Aus der Geschichte lernen“ ist eine oft gestellte Forderung. Sie stellt sich als zwiespältig, ja paradox heraus, denn sie missachtet, dass Geschichte die vergegenwärtigte Vergangenheit ist, nicht das Vergangene selbst. Angesichts der Erfahrungen des 1.Weltkrieges erschien Paul Valery der Gedanke, man könne etwas aus der Geschichte lernen, geradezu „lachhaft“ (Essay „Über die Geschichte“, 1927).
Im abschließenden Teil geht es um die Geschichtspolitik. Alle historischen Begriffe, Theorien, Erzählungen dienen – darauf zielt Geschichtspolitik - auch gegenwärtigen weltanschaulichen, politischen Positionen. Die gegenwärtige Generation schafft sich ihre Geschichte, indem sie auf die Taten der vorangegangenen Generation Bezug nimmt und sie beurteilt. Sie braucht sie, um ihre eigenen Positionen zu definieren, sie braucht sie für ihre Aktionen und Unterlassungen, für ihr Selbstverständnis, für ihre Identifikationen. Beispielhaft war der deutsche Historikerstreit von 1986 (kein Streit um die Fakten: die wurden von allen gleichermaßen anerkannt; es war ein Streit um die Bedeutung dieser Fakten).
Die Geschichtspolitik erweist sich oft als polarisierend (man denke an die heftigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen bei Projekten wie Museen, Denkmälern). Dass die Geschichtspolitik auch eine integrative Aufgabe hat, zeigte die berühmte Weizsäcker-Rede vom 9. Mai 1945. Der Blick zurück kann das Gemeinsame betonen und zu einem gemeinsamen politischen Handeln führen – zum Beispiel zur europäischen Integration.
Um den Realitätssinn angesichts der Geschichte zu schärfen, erinnert der Vortrag an die Friedensbemühungen zwischen Israelis und Palästinensern, an den Handschlag von Yitzhak Rabin und Yassir Arafat 1993, an die formulierten Rahmenbedingungen damals und an Rabins spätere Ermordung: Für solche mutigen Gesten kann man – so der Vortragende -, unter günstigen Umständen den Friedensnobelpreis erhalten; aber die Chance, bei der nächsten Wahl wiedergewählt zu werden, hat man damit wohl verspielt. Gewiss, es werden sich überzeugte Wähler finden – aber keine Mehrheit.
Auch der letzte Absatz des Vortrags sei hier im Wortlaut wiedergegeben: Wir haben eine Vergangenheit, aber wir geben uns eine Geschichte – das würde ich als Motto oder Kürzestresumée unter mein Referat schreiben. Wir haben eine Vergangenheit, die können wir nicht ändern. Doch wir geben uns, im erinnernden Erzählen, eine Geschichte, und dabei sind wir zu Wahrhaftigkeit und kritischer Vernunft gefordert; zur Distanz ebenso wie zum kommunikativen commitment gegenüber der Geschichte des Anderen.