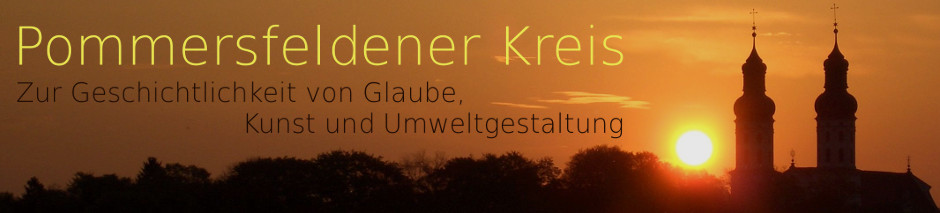Für Aristoteles (384–322 v. Chr.) gehört die Frage, warum manche Lebewesen länger leben als andere und welche Faktoren überhaupt die Länge der Lebensspanne bestimmen, zum Aufgabenbereich der Philosophie, genauer gesagt, der Naturphilosophie. Er widmet ihr eine eigene kleine Schrift, Von der Länge und Kürze des Lebens, ein Traktat der sogenannten Parva naturalia (“Kleine naturwissenschaftliche Schriften”), in der er die naturphilosophischen Prinzipien untersucht, die der Lebensdauer zugrunde liegen und die unterschiedlichen Lebensspannen sowohl verschiedener Arten von Lebewesen als auch einzelner Individuen bestimmen. Dies hat zunächst mit dem Aufbau des Körpers aus den vier Elementen bzw. Elementarqualitäten zu tun: die charakteristischen Eigenschaften des lebendigen Körpers sind Wärme und Feuchtigkeit, die des toten Kälte und Trockenheit. Die Lebensspanne eines Lebewesens ist daher bestimmt durch den Anteil von Wärme und Feuchtigkeit in seiner elementaren Mischung, und durch seine Fähigkeit, sich diese Anteile über die Zeit hinweg zu erhalten. Diese Fähigkeit ist hinwiederum bestimmt von der “Struktur” seiner hylomorphischen Seele und davon, wie es seine fundamentalen Lebensfunktionen ausführt (worin sich z.B. Pflanzen grundsätzlich von Tieren unterscheiden). Eine Frage, für die sich Aristoteles in diesem Zusammenhang offenbar nicht interessiert, ist hingegen diejenige, wie der einzelne Mensch sicherstellen kann, die ihm theoretisch mögliche maximale Lebensspanne zu erreichen, etwa durch eine gesunde Lebensweise.
Dies ist anders bei seinen mittelalterlichen arabischen Lesern, die großenteils nicht nur philosophisch, sondern auch medizinisch gebildet waren. Hier tritt der medizinische Aspekt des Themas in den Vordergrund: wie kann der Mensch sein Leben möglichst lange ausdehnen? Diese Änderung der Blickrichtung ist auch dem Einfluss des griechischen Arztes Galen (129–216(?) n. Chr.) zu verdanken, der z.B. in seiner Schrift De sanitate tuenda (“Über die Erhaltung der Gesundheit”) die Gesunderhaltung des gesunden Körpers als wichtigen Teilbereich der Medizin beschrieben hatte, was auch in der arabischen Medizin beibehalten wurde (so z.B. bei Avicenna (Ibn Sīnā), gest. 1037 n. Chr., und Averroes (Ibn Rušd), 1126–1198 n. Chr.)
Dieser galenische Einfluss ist schon in der arabischen Adaption des aristotelischen Traktats Von der Länge und Kürze des Lebens zu bemerken ( Fī ṭūl al-ʿumr wa-qiṣarihi, anonym, wahrsch. 9. Jhdt. n. Chr.), in dem Aristoteles’ Thesen vereinfacht wiedergegeben werden und der Fokus vom Tierreich weg hin auf die Lebensdauer des Menschen verschoben wird (z.B. durch die Einführung eines Beispiels, in dem Eunuchen mit nicht verschnittenen Männern verglichen werden). So wird hier diskutiert, wie Nachteile von diversen Körpermischungen durch klimatische Faktoren und die richtige Ernährung ausgeglichen werden können, und explizit dazu aufgerufen, dies auch zu tun.
In seiner interpretierenden Paraphrase der arabischen Adaption des aristotelischen Textes (Talḫīṣ Kitāb al-Ḥiss wa-l-maḥsūs, Kap. 3: Fī ṭūl al-ʿumr wa-qiṣarihi) nimmt Averroes diese Tendenz auf und verstärkt sie noch weiter; allerdings liefert er für die in der arabischen Adaption verkürzt dargestellten Zusammenhänge auch naturphilosophische Hintergrundtheorien, die er anderen Schriften des Aristoteles entnimmt (z.B. Über Werden und Vergehen).
Bei dem fast 300 Jahre älteren Arzt, Übersetzer und Gelehrten Qusṭā ibn Lūqā (gest. 912/3 n. Chr.), der einen Traktat mit einem an Aristoteles’ Schrift angelehnten Titel verfasst hat – Von der Länge und Kürze des Lebens und der Physiognomie der Langlebigen – tritt die philosophische Fragestellung sozusagen gänzlich in den Hintergrund; und das, obwohl Qusṭā explizit vorgibt, die Frage unter philosophischen sowie medizinischen Gesichtspunkten untersuchen zu wollen. Abgesehen vom Titel beinhaltet sein Werk aber nur eine einzige direkte Bezugnahme auf Aristoteles und seine Schrift zum Thema: Qusṭā nimmt das Beispiel vom Eunuchen auf, das sich in der arabischen Adaption (nicht aber im griechischen Original) des aristotelischen Traktats findet. Ansonsten ist seine Schrift wesentlich von Galens De sanitate tuenda beeinflusst.
Die Geschichte der arabischen Rezeption von Aristoteles’ Von der Länge und Kürze des Lebens zeigt damit zum einen die große Nähe von (Natur-)Philosophie und Medizin, die man in der Antike, aber eben besonders auch im arabischen Mittelalter beobachten kann, wo Philosophen wie Avicenna und Averroes auch als Ärzte tätig waren und neben philosophischen auch medizintheoretische Werke verfassten. Diese Nähe scheint es ermöglicht zu haben, dass ein Thema wie die Länge und Kürze des Lebens aus dem philosophischen ins medizinische Fach hinüberwechseln konnte, ohne dass dies überhaupt explizit gemacht wurde. Ein weiterer Faktor, der diese Entwicklung zu einem wesentlichen Teil mit zu verantworten hat, ist der der Übersetzung: den arabischen Lesern war Aristoteles’ Schrift nur in der schon veränderten arabischen Fassung bzw. Adaption bekannt (eine mehr am Wortlaut orientierte Übersetzung scheint es nicht gegeben zu haben). Diese Adaption, welche die Vereinnahmung des Themas durch die Medizin im weiteren Verlauf ganz sicher mit angestoßen hat, belegt aber selbst bereits das medizinische Interesse ihres Bearbeiters, und ist damit auch selbst schon Teil des Prozesses der Aneignung dieses philosophischen Themas durch die Medizin.